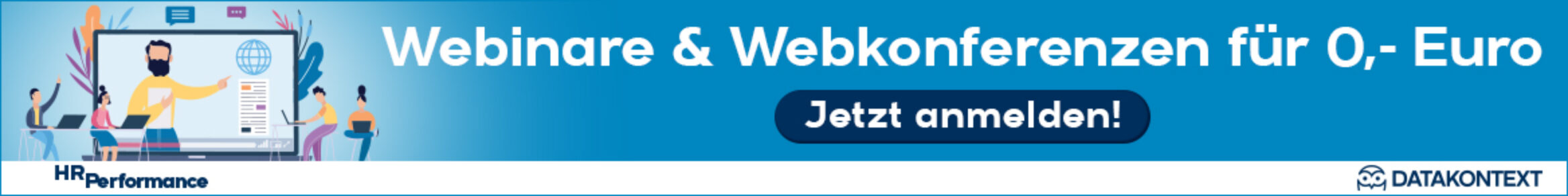Die Wahl zwischen Geld und Zeit im Schichtbetrieb einfach ermöglichen!
Immer mehr Vollzeitbeschäftigte wünschen sich kürzere Arbeitszeiten. Daher kann es nicht erstaunen, dass Tarifverträge den Arbeitnehmer*innen zunehmend die Wahl zwischen Geld und Zeit ermöglichen, wobei es diesbezüglich bisher überwiegend „nur“ um die Verwendung von Entgeltzuwächsen geht.

Unser Autor, Dr. Andreas Hoff, Spezialist für Personaleinsatzplanung, zeigt in seinem neuesten Beitrag auf, wie die Wahl zwischen Geld und Zeit auch im Schichtbetrieb einfach ermöglicht werden kann.
Immer mehr Vollzeitbeschäftigte wünschen sich kürzere Arbeitszeiten – besonders in der Form zusätzlicher freier Tage, was im Schichtbetrieb naturgemäß besonders naheliegt und gerade hier zur Reduzierung der gesundheitlichen und sozialen Belastungen besonders nützlich ist. Daher kann es nicht erstaunen, dass Tarifverträge den Arbeitnehmer*innen zunehmend die Wahl zwischen Geld und Zeit ermöglichen, wobei es diesbezüglich bisher überwiegend „nur“ um die Verwendung von Entgeltzuwächsen geht.
Und das kommt sehr gut an. So hat in 2022 eine, wenn auch nicht repräsentative Befragung von 3.000 Beschäftigten ergeben, dass sich, wenn sie zwischen mehr Geld und mehr Zeit wählen können, 59 Prozent für mehr Zeit entscheiden, 6 Prozent für eine Kombination aus Zeit und Geld und 34 Prozent für eine Sonderzahlung oder monatliche Entgelterhöhung.
Wahlmöglichkeiten sind bei Arbeitnehmenden sehr beliebt
Hierfür ein erstes Beispiel: In der Metallindustrie kann seit 2019 ein Teil der Arbeitnehmer*innen, die entweder schichtig arbeiten oder häusliche Pflege- oder Betreuungsaufgaben erfüllen, das damals neu eingeführte tarifvertragliche Zusatzgeld (T-ZUG) in Höhe von 27,5 Prozent eines Monatsentgelts in 8 freie Tage pro Jahr umwandeln; in der Ende 2024 beendeten Tarifrunde wurden die diesbezüglichen Wahlmöglichkeiten noch etwas ausgebaut.
Es gibt allerdings auch deutlich darüberhinausgehende Ideen. So fordert die Gewerkschaft ver.di in der gerade anlaufenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst die Einführung eines „Meine-Zeit-Kontos“, auf das die Arbeitnehmer*innen nicht nur Entgeltsteigerungen, sondern auch Überstunden, Zuschläge, o. Ä. buchen können, die dann für eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit, für zusätzliche freie Tage oder längere Freistellungsphasen genutzt werden können sollen. Auf dieses Konto sollen dann auch die zusätzlichen 3 (für Gewerkschaftsmitglieder 4) freien Tage gebucht werden können, die ver.di als Ausgleich für eine zunehmende Arbeitsverdichtung fordert.
Gemeinsamer Nenner dieser Regelungen bzw. Regelungs-Ideen ist es, Mitarbeiter*innen die Möglichkeit zu geben, ohne Reduzierung der Vertragsarbeitszeit weniger zu arbeiten – also insbesondere als Vollzeitbeschäftigte*r faktisch teilzeitbeschäftigt zu sein. Letzteres führt je[1]doch, wie nachfolgend gezeigt wird, zu einer – aus meiner Sicht auch rechtlich problematischen – Ungleichbehandlung von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten, weil bei gleicher effektiver Arbeitszeitdauer unter auch ansonsten gleichen Umständen die Vollzeitbeschäftigten, die sich für Zeit entscheiden, pro Stunde effektiv mehr verdienen als die Teilzeitbeschäftigten, ohne dass dafür ein dies rechtfertigender Grund vorliegen würde.
Fair und außerdem viel einfacher ist es, von den Mitarbeiter*innen gewünschte Umwandlungen von Geld in Zeit stattdessen mittels Reduzierungen der Vertragsarbeitszeit zu realisieren – wie im folgenden Beispiel:
Die Regelarbeitszeit beträgt 40h/w und wird gleichmäßig auf MO-FR verteilt, das Monatsentgelt beträgt 4.000 Euro (brutto – stets auch im Folgenden).
Der Arbeitgeber möchte seinen Mitarbeiter*innen nun die Möglichkeit geben, die anstehende Entgelterhöhung um 5 Prozent ganz oder teil[1]weise „in Zeit“ zu nehmen, wobei ihre diesbezügliche Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder mit Wirkung für die Zukunft revidiert werden können soll. Dazu bietet er ihnen an, ihre Vertragsarbeitszeit künftig innerhalb eines Korridors von 38-40h/w in Stundenschritten selbst zu bestimmen: Und zwar mit 6 Monaten Ankündigungsfrist zum folgenden Kalenderjahr, damit hierdurch eventuell bewirkte Reduzierungen oder, wenn Arbeitnehmer*innen auf eine höhere Vertragsarbeitszeit wechseln, Anhebungen der Personalkapazität bei Bedarf noch rechtzeitig ausgeglichen werden können, sowie zwecks Vereinfachung der Urlaubsberechnung (auch in diesem Zusammenhang empfiehlt sich die Forcierung des Prinzips „Urlaubsjahr = Kalenderjahr“).
Wechselt ein*e Mitarbeiter*in nun auf 39h/w, beträgt sein*ihr Monatsentgelt unter Berücksichtigung der 5 Prozent Entgeltsteigerung 4.095 Euro, sodass er*sie hierdurch im Ergebnis etwas mehr als die Hälfte des monatlichen Entgeltzuwachses von 200 Euro „in Zeit“ umsetzt.
Wechselt er*sie auf 38h/w, bleibt das Monatsentgelt in etwa gleich (ganz genau nimmt es um 10 Euro auf 3.990 Euro ab), sodass hiermit der gesamte Entgeltzuwachs und ein kleiner Teil des Bestandsentgelts „in Zeit“ umgewandelt wird.
Im Schichtbetrieb werden diese Arbeitszeitverkürzungen am einfachsten so umgesetzt, dass die betreffenden Mitarbeiter*innen pro tatsächlichen oder planmäßigen Arbeitstag bei z. B. durchschnittlicher 5-Tage-Woche und 8h Arbeitszeit pro Schicht eine Arbeitszeitkonto[1]Gutschrift von 0,2h bzw. 0,4h erhalten, woraus sich dann vor krankheitsbedingten Ausfällen ca. 5,5 bzw. 11 individuelle Freischichten pro Jahr ergeben.
Bei künftigen Entgelterhöhungen kann der Wahl-Korridor dann einfach entsprechend erweitert werden – z. B. auf 36–40h/w, etc. Oder es wird gleich mit einem auf das Bestandsentgelt erweiterten Ansatz lebensphasenorientierter Arbeitszeitgestaltung gestartet, der den Mitarbeiter*innen etwa die Möglichkeit gibt, ihre Vertragsarbeitszeit immer wieder neu zwischen z. B. 32h/w (im vorliegenden Beispiel bedeutete dies eine durchschnittliche 4-Tage-Woche) und 40h/w festzulegen („Wahlarbeitszeit“).
Lesen Sie den vollständigen Beitrag aus der HR Performance 1/2025.
Weitere Artikel zum Thema