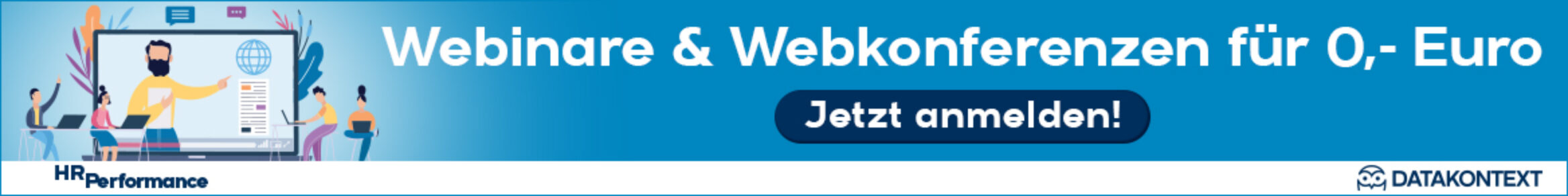Kameras an – Stimmen aus? : Warum Sichtbarkeit nicht mit Teilhabe verwechselt werden sollte
Sichtbarkeit gilt oft als Zeichen von Aufmerksamkeit und Beteiligung. Doch: Wer sichtbar ist, wird nicht automatisch gehört – und schon gar nicht eingebunden. Was sind Herausforderungen hybrider Meetings?

„Kameras an, bitte!” Dieser Satz eröffnet mittlerweile viele virtuelle Meetings. Sichtbarkeit gilt oft als Zeichen von Aufmerksamkeit und Beteiligung. Doch: Wer sichtbar ist, wird nicht automatisch gehört – und schon gar nicht eingebunden.
Laut dem Gallup Engagement Index 2024 sind nur 9 % der deutschen Beschäftigten emotional stark mit ihrem Unternehmen verbunden. Für Arbeitgeber dürfte das eine durchaus erschreckende Zahl sein. Im selben Jahr arbeiteten laut Statistischem Bundesamt 24,1 % regelmäßig im Homeoffice – ein Hinweis auf veränderte Formen der Zusammenarbeit. Digitale Sichtbarkeit, etwa durch die Kamera, reicht dabei leider nicht aus, um Zugehörigkeit oder Teilhabe zu fördern. Besonders in großen Runden sprechen oft nur wenige. Der Rest hört zu oder schaltet innerlich ab.
Zwischen Präsenz und Partizipation
Viele Remote-Beschäftigte berichten von einem Mangel an Einbindung. Eine Studie von Vyopta, die über 40 Millionen Meetings auswertete, zeigt: Die „No‑participation“-Rate stieg von 4,8 % (2022) auf 7,2 % (2023). Das Problem ist nicht neu: Schon lange vor der Pandemie wurde über die Effizienz von Meetings diskutiert. In hybriden Settings verschärfen sich diese Herausforderungen jedoch. Was fehlt, sind Rahmenbedingungen, die über reine Anwesenheit hinaus echte Partizipation ermöglichen.
Herausforderungen hybrider Meetings
Hybride Meetings bergen eine Reihe von Hindernissen, die es zu erkennen und zu meistern gilt, um alle Teilnehmer*innen gleichermaßen einzubeziehen:
- Virtuelle Isolation: Eine große Herausforderung ist die Gefahr, dass sich Teilnehmer*innen, die remote zugeschaltet sind, weniger eingebunden fühlen. Spontane Beiträge, informelle Gespräche vor und nach den Meetings sowie der Austausch von Blicken und Gesten finden oft unbewusst und ausschließlich unter den physisch Anwesenden statt – digitale Teilnehmer*innen bleiben hier außen vor. Dieses Ungleichgewicht verstärkt das Gefühl, Zuschauer*in statt Mitgestalter*in zu sein.
- Kamerapflicht mit Nebenwirkungen: In einem Experiment der American Psychological Association wirkte sich die Verpflichtung zur Kameranutzung gerade bei zurückhaltenden Mitarbeiter*innen negativ auf das Engagement aus. Die ständige Selbstbeobachtung und das Gefühl, im Fokus zu stehen, können die spontane Beteiligung hemmen und zu Unbehagen führen.
- Ablenkung durch Multitasking: Multitasking ist bei Online-Meetings weit verbreitet – laut Flowtrace machen bis zu 92 % der Teilnehmer*innen regelmäßig etwas anderes nebenbei. Wenn einzelne Personen durch externe Faktoren oder private Beschäftigungen abgelenkt sind, leidet die kollektive Aufmerksamkeit, was die Effektivität von Besprechungen oder Kollaborationen erheblich mindert. Die Konsequenz ist oft eine reduzierte Produktivität, da wichtige Informationen nicht erfasst und Entscheidungen auf einer unvollständigen Basis getroffen werden. Das frustriert jene, die vorbereitet und engagiert teilnehmen, da ihre Bemühungen nicht die Resonanz finden, die sie verdienen.
- Technische Hürden: Schlechte Audio- oder Videoqualität, instabile Internetverbindungen, veraltete Hard- und Software oder fehlende technische Ausstattung können die Teilnahme an Besprechungen erheblich erschweren. Es ist ist frustrierend, nicht gehört oder gesehen zu werden, oder aufgrund technischer Probleme den Anschluss zu verlieren. Viele meiden es daher, in hybriden Meetings zu sprechen, aus Angst vor technischen Problemen. Dadurch bleibt ihre Stimme ungehört, obwohl sie sich äußern wollen, was wertvolle Beiträge und andere Blickwinkel verhindert.
Wege zu einer inklusiven und produktiven hybriden Meetingkultur
Um den Herausforderungen erfolgreich zu begegnen und hybride Meetings so zu gestalten, dass sie für alle Teilnehmenden wertvoll sind, bedarf es eines bewussten Umdenkens, der Einführung neuer Strategien und einer ständigen Anpassung.

Moderation als Schlüsselrolle
Eine gute Moderation ist das Herzstück produktiver hybrider Meetings. Sie sorgt dafür, dass sich alle Teilnehmenden gleichermaßen einbezogen fühlen und ihre Beiträge optimal zur Geltung kommen. Wichtig sind:
- Klare und detaillierte Agenda: Eine klare und realistische Agenda ist entscheidend für erfolgreiche Meetings, da sie Fokus und Orientierung bietet. Nur 37 % der Besprechungen nutzen diese aktiv, was oft zu ineffektiven Ad-hoc-Diskussionen führt. Eine konkrete Agenda hilft besonders ruhigeren Teilnehmenden, sich vorzubereiten und fundiertere Beiträge zu leisten, da der Druck spontaner Beteiligung sinkt. Ohne Agenda fehlt zudem die Verantwortlichkeit für Folgemaßnahmen, was sich negativ auf Team- und Projektergebnisse auswirkt.
- Visualisierung von Beiträgen: Wenn im Raum auf Whiteboards oder Flipcharts gearbeitet wird, sollten diese für Online-Teilnehmende sichtbar gemacht werden (z.B. durch eine zusätzliche Kamera). Dies ermöglicht es allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dem Diskussionsverlauf aktiv zu folgen und sich besser einzubringen, da alle auf dem gleichen Stand sind.
- Aktives Einbinden von allen Beteiligten: Um sicherzustellen, dass sich alle gleichberechtigt fühlen und aktiv einbringen können, ist eine bewusste und inklusive Moderation essenziell. Sie sollte aktiv darauf achten, alle Stimmen zu hören und Remote-Arbeitende gezielt in die Diskussion einzubeziehen, z.B. durch direkte Ansprache oder digitale Tools für gemeinsame Brainstormings oder Abstimmungen.
Feedbackschleifen und Nachbereitung etablieren
Ein weiteres zentrales Element ist die konsequente Nachbereitung. Gerade hybride Formate profitieren von klaren Feedbackprozessen, um die Qualität von Besprechungen stetig zu verbessern: Kurze Puls-Checks oder anonyme Feedbackformulare nach Meetings ermöglichen eine schnelle Einschätzung der Beteiligung, Verständlichkeit und des generellen Meetingnutzens. Regelmäßige Retrospektiven fördern kontinuierliches Lernen und ermöglichen es, strukturelle Barrieren systematisch abzubauen. Wichtig dabei: Das Feedback sollte nicht nur gesammelt, sondern auch sichtbar in Maßnahmen umgesetzt werden – nur so entsteht Vertrauen und Beteiligung auf Augenhöhe.
Kultur des Miteinanders aktiv stärken
Teilhabekultur beginnt nicht erst im Meeting selbst, sondern ist Ausdruck eines ganzheitlichen Führungsverständnisses, das psychologische Sicherheit, Empathie und transparente Kommunikation fördert. Führungskräfte sind hier als Vorbilder gefragt: Wer zuhört, Unsicherheiten offen thematisiert und auch eigene Fehler teilt, schafft Raum für Beteiligung und Offenheit im Team.
Darüber hinaus gilt es, die Erreichbarkeit neu zu denken. In hybriden Strukturen verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, weshalb eine inklusive Meetingkultur individuelle Bedürfnisse respektieren sollte – etwa durch flexible Zeitfenster, asynchrone Beteiligungsmöglichkeiten oder meetingfreie Zeiten. Nicht zuletzt ist es wichtig, Raum für Begegnung zu schaffen: Digitale Kaffeepausen, Peer-Formate oder einfache Check-ins stärken den sozialen Zusammenhalt und geben auch leisen Stimmen Raum, sich ohne Leistungsdruck zu zeigen.
Teilhabe braucht Struktur und Haltung
Echte Teilhabe erfordert mehr als Technik: Sie braucht Strukturen, die Beteiligung und Vielfalt fördern, sowie eine Haltung, die auf Vertrauen und Wertschätzung basiert. Sichtbarkeit ist nur ein Aspekt, keine Garantie. Führungskräfte sind entscheidend, um aus reiner Anwesenheit echte Teilhabe zu machen und so die Lebendigkeit, Zusammenarbeit und Wirksamkeit in der hybriden Arbeitswelt zu steigern.

Jean Bays gestaltet als Head of People bei Neat zukunftsfähige Arbeitsumfelder und Programme zur Mitarbeiterbindung. Sie bringt langjährige Erfahrung in HR-Strategie, Change Management und Leadership Development mit und war zuvor in leitenden Positionen bei Nevro, EMD Millipore und Cielo Talent tätig.