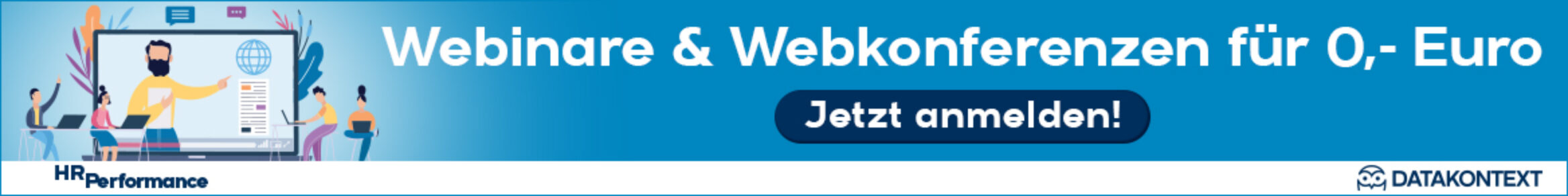Feedbackgetriebenes Handeln : Was sich durch gezieltes Employee Listening erreichen lässt
Dass Veränderungen scheitern, wird gerne auf Widerwillen zurückgeführt. Doch wer Führungskräften zuhört, wird feststellen, dass sie ganz andere Fragen plagen. Nämlich, was sie eigentlich (noch) tun sollen und wie sie aufbauend auf dem Feedback aus immer häufigeren Befragungen im Arbeitsalltag effizient neue Maßnahmen ankurbeln sollen

Mitarbeitendenbefragungen sind etablierte Instrumente – aber was kommt dann? Feedback zu geben, lohnt sich aus der Sicht der Beitragenden nur dann, wenn daraus etwas Positives für sie selbst, die eigene Arbeitsumgebung oder das Unternehmen herausspringt. Genau das ist aber bislang zu selten geschehen, so dass die jährlich wiederkehrenden Befragungsprojekte oft schon mit Skepsis erwartet werden. Doch in den letzten Jahren hat sich viel getan: Feedback-getriebene Veränderungen gewinnen an Dynamik, Formaten und Verantwortlichen. Daher gehört das Veränderungspotenzial von Feedback-Instrumenten auf den Prüfstand gestellt.
Feedback entfaltet Wirkung
Jeder kennt die kritischen Stimmen, dass sich nach Mitarbeitendenbefragungen “ja doch nichts verändert”. Laut Qualtrics EX Trend Report 2025 sagen jedoch 63 % aller befragten abhängig Beschäftigten weltweit, dass sie Veränderungen als Konsequenz aus den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen spüren. Das entspricht der deutlichsten Steigerung aller abgefragten Themen des Reports. Für Deutschland liegt der Wert mit 58 % zwar unter dem weltweiten Durchschnitt, aber die Lücke schließt sich langsam (siehe Abbildung; eigene Auswertung). Hierzulande ist dieses Ergebnis besonders vielversprechend, weil sich das Veränderungsgefühl nach Mitarbeitendenbefragungen in Deutschland – noch stärker als in anderen Ländern in EMEA – als wesentlicher Treiber für das Engagement von Mitarbeitenden zeigt (Sonderauswertung des Qualtrics XM Instituts). Je effektiver agiert wird und die Dinge angeschoben werden, umso eher entsteht/steigt die Motivation bei den Mitarbeitenden.
Aus den Antworten auf die Frage, ob es die Gelegenheit gab, die letzten Befragungsergebnisse zu besprechen (61 % Zustimmung in 2025 vs. 57 % in 2024 und 45 % in 2023;) geht auf globaler Ebene ein fast identisch positiver Trend hervor. Offenkundig ist weltweit der Druck, durch eine positive Experience in unsicheren Zeiten das Personal zu binden, die Produktivität hochzuhalten bzw. zu steigern und neue Beschäftigte zu gewinnen, ein treibender Faktor.

Wahrnehmung von Veränderungen infolge von Mitarbeitendenbefragungen
Zuhören nicht zurückfahren
Das untermauern auch die Ergebnisse einer Untersuchung des Qualtrics XM Institute 2024, das die Fähigkeit, zu zeigen, dass etwas mit dem Feedback der Beschäftigten geschieht, als eines der wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale von High Performance-Unternehmen identifiziert. Ebenso entscheidend ist die Wahrnehmung, dass die eigenen Ideen und Vorschläge zählen und inwiefern die Geschäftsleitung die Wichtigkeit der Beschäftigten für den Unternehmenserfolg verdeutlicht.
Gerade in transformationsgetriebenen Unternehmen ist es ratsam, das Zuhören nicht zurückzufahren, sondern es als Chance zu ergreifen. Laut der genannten Studie sind Mitarbeitende, die Veränderungen erkennen, wesentlich engagierter (55 Prozentpunkte) als diejenigen, die keine Veränderungen sehen. Umso erfreulicher, dass dies offensichtlich immer mehr Arbeitgebern bewusstwird und sie entsprechend agieren.
Feedbackgetriebene Veränderungen – viele Ebenen, Formate und treibende Kräfte
Zwar haben Feedbackabfragen einen hohen Eigenwert für die Unternehmen – allein schon zur Förderung von Transparenz und Datenfokus, zur Ideengewinnung, zur Vermittlung von Wertschätzung, usw. Doch sie müssen auch einen Mehrwert liefern, der unmittelbar deutlich wird. Für viele ist dies der wirtschaftliche Nutzen. Dieser lässt sich zwar gut simulieren, allerdings wird keine Nutzenkalkulation zur Realität, wenn mit den Ergebnissen nicht gearbeitet wird.
Daher sind spürbare Initiativen, Folgeprojekte und strukturelle Maßnahmen die besten Belege dafür, was Feedback bewirken kann. Einige Beispiele für größere Initiativen aus der Praxis der letzten 2-3 Jahre in weltweit agierenden Großunternehmen (mit Sitz in Deutschland) hierfür sind folgende:
Branche | Feedbackformat | Priorisierte Themen | Veränderungsprojekte: Beispiele |
|---|---|---|---|
IT | Candidate Experience | • Vorbereitung von Hiring Managern | • Hiring Manager-Trainings |
Automotive / Konglomerat | Verschiedene Lifecycle Experience-Befragungen | • Organisation von Weiterbildung | • Dedizierte Anpassungen der internen Weiterbildungskonzepte |
Pharma | Mitarbeitendenbefragung und 360°-Feedback | • Diskrepanzen in der Wahrnehmung der Führungskräfte + starke Wirkung auf Mitarbeitenden-Engagement | • Dedizierte Führungskräftequalifizierung |
Automotive | Mitarbeitendenbefragung | • Fehlende Feedbackkultur | • Entwicklung eines vielschichtigen Employee Listening-Programms (Puls-Checks, Lifecycle-Feedback, neues 360°-Verfahren, u.a.) |
Handel | Datenkombination aus Mitarbeitendenbefragungen und Kundenzufriedenheitsstudien | • Trainingsbewertung als einer der wichtigsten Treiber für die Zufriedenheit der Kunden in den Geschäften | • Re-Design der Trainings für die Mitarbeitenden in den Geschäften |
Hieran zeigt sich auch, dass es nicht ausschließlich um klassische Mitarbeitendenbefragungen (im Silo ausgewertet) geht, sondern echte Veränderungen aus einem ganzen Strauß von Feedback-Formaten abgeleitet werden können. Die Verantwortlichen sind die zuständigen fachlichen Teams, etwa fürs Recruiting, das Onboarding oder die Personalentwicklung. Führungsaufgabe Mitarbeitendenbefragung – wie in so vielen Beiträgen suggeriert – stimmt deshalb heute angesichts der neuen Formatvielfalt nur noch teilweise.
Doch neben den unternehmensweiten Initiativen kommt es speziell bei den klassischen Engagement-, aber auch bei zentralen und lokalen Pulse- sowie 360°-Befragungen entscheidend darauf an, wie die Verantwortlichen das Feedback in ihrem jeweiligen Bereich bzw. teils zu ihrer eigenen Person aufgreifen und verwerten. Dazu zählen beispielsweise Team- und Abteilungsleitende oder auch Tribe-Leader in agil aufgestellten Einheiten. Auf diesen Ebenen lassen sich Veränderungen für die Beschäftigten unmittelbarer erkennen. Außerdem ist die Einbindung der Mitarbeitenden, zum Beispiel in Form von Mitreden und -planen, einfacher als auf höher aggregierten Ebenen. Insbesondere Entscheider auf der mittleren Führungsebene, etwa Bereichsleitungen oder Regionalverantwortliche – in klassischen Mitarbeitendenbefragungen oftmals wenig beachtet – sind diejenigen, die vergleichsweise große, aber immer noch erkennbare Hebel bewegen können.
Befragungen nur mit späteren Maßnahmen?
„Ohne spätere Maßnahmen besser keine Befragung durchführen” wird gebetsmühlenartig immer wieder behauptet, trifft mitunter aber nicht zu. Es ist sicher nicht realistisch, nach jedem Feedback neue Maßnahmen zu erfinden, vor allem, wenn öfter befragt wird. Aber insgesamt scheint mehr zu passieren, denn es lässt sich eine deutlich positivere Veränderungswahrnehmung derjenigen Beschäftigten feststellen, die sogar monatlich Feedback geben können (74 %), als bei denjenigen, die nur einmal im Jahr befragt werden (59 %) (Qualtrics EX Trend Report 2025, Sonderauswertung). Diese 15 Prozentpunkte sind die größte Kluft von allen gemessenen Aspekten, differenziert nach der Häufigkeit der Feedback-Gelegenheiten. Vermutlich ist auch die Chance geringer, dass ein Vorhaben versandet, wenn es schon bald wieder im Fokus steht. Das heißt, wenn es gut vorangeht und sich die priorisierten Themen nicht geändert haben, muss nicht unbedingt interveniert werden. Das wiederum hilft, Befragungs-Müdigkeit zu vermeiden. Bei Stillstand oder neuen Herausforderungen lassen sich hingegen schnell neue Initiativen ergreifen. Entscheidend ist, immer wieder die Gründe für die Kurs-Beibehaltung, etwaige Anpassung der vereinbarten Initiativen oder die Notwendigkeit neuer Aktivitäten zu kommunizieren.
Neuer Nachdruck durch neue Technologien
Dass Veränderungen scheitern, wird gerne auf Widerwillen zurückgeführt. Doch wer Führungskräften zuhört, wird feststellen, dass sie ganz andere Fragen plagen. Nämlich, was sie eigentlich (noch) tun sollen und wie sie aufbauend auf dem Feedback aus immer häufigeren Befragungen im Arbeitsalltag effizient neue Maßnahmen ankurbeln sollen. Hier schwingt eine gewisse Ratlosigkeit mit, die tatsächlich in Widerwillen umschwenken kann. Statt sie mit Formatvorlagen zur Maßnahmenplanung sowie (Online-) Kursen zu guter Führung abzuspeisen (mit hohem Sarkasmusrisiko), können heute moderne technische Lösungen mit neuen Funktionen zur verbesserten inhaltlichen und prozessualen Maßnahmenplanung helfen, die Ratlosigkeit abzubauen und Veränderungen deutlich spürbarer zu machen:
- Bessere Lösungen: Während es in der Vergangenheit lediglich generische Best Practice-Bibliotheken gab, lassen sich inzwischen KI-basierte Tools nutzen, die nicht nur personalisierte Maßnahmenvorschläge für Führungskräfte basierend auf ihren quantitativen und qualitativen Ergebnissen, ihrem Profil sowie ihren Gewohnheiten und Präferenzen unterbreiten, sondern diese auch begründen. Das kann die Entscheidung für die richtigen Schritte maßgeblich beeinflussen.
- Gemeinsames und effizientes Handeln: Tools zum gemeinsamen Brainstorming und Priorisieren von Ideen binden nicht nur Teammitglieder ein, sondern sind gerade nach häufigeren Befragungen ein effizientes Mittel, um die vorgeschlagenen Maßnahmen im Team zu verifizieren und schnell zusätzliche Möglichkeiten zusammen auszuloten.
- Sofortige spürbare Effekte: Individuelle Experience-Verbesserungen können durch neue technische Möglichkeiten schnell erzielt werden, zum Beispiel, wenn bei (zumeist negativem) Feedback direkt Tickets in verschiedenen Systemen erzeugt oder die Zuständigen benachrichtigt werden, damit diese zeitnah intervenieren können. Dies ist besonders in Lifecycle- und Candidate Experience-Projekten praktikabel, wo es oft unter anderem um individuelle Hilfestellung geht.
Technologie ist nur ein Baustein erfolgreicher feedbackbasierter Veränderungsaktivitäten. Natürlich hängt der Erfolg ebenso von der Einbindung der “Betroffenen”, gutem Change-Management, von Kommunikation (auch von gelungenen Vorreiter-Beispielen und deren Effekten), dem Ausprobieren, Scheitern-dürfen, Lernen, der Befähigung, sowie Sponsorships, internen Alliierten, der Erfolgsmessung (auch durch Feedback!), etwaigen Anreizen, der Integration in bestehende Abläufe, usw. ab. Allerdings entwickeln sich besonders die technischen Funktionalitäten zur Unterstützung von Wandel rasant weiter, was sie, wo genutzt, statt zum Hemmschuh, immer mehr zum Katalysator für positive Veränderungen macht.
Fazit
Wer den Mitarbeitenden aktiv zuhört sowie ihr Feedback und ihre Empfehlungen zielgerichtet in Maßnahmen überführt, hat McKinsey zufolge eine 80 % höhere Wahrscheinlichkeit, neue und innovative Verfahrensweisen zu verwirklichen. Zunehmend mehr Unternehmen, ihre Führungskräfte und thematisch Verantwortlichen haben dies erkannt, und hören immer häufiger und besser zu, um mehr zu bewegen. Wer die richtigen Fragen zu den passenden Themen an die geeigneten Zielgruppen zum richtigen Zeitpunkt stellt, kann dementsprechend zielgerichtet handeln. Es gilt dabei die Balance aus „Weniger ist mehr” und „Viel hilft viel” zu finden. Neue technologische Lösungen können helfen, die Impulse, Mitwirkungsbereitschaft und Praktikabilität zu erhöhen. Denn wie Aldous Huxley einst sagte: „Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt, sondern Erfahrung ist, was man aus dem macht, was einem zustößt.”

Dr. Roland Abel verantwortet bei Qualtrics die Employee Experience Strategy EMEA und unterstützt Kunden mit seiner 20-jährigen Expertise bei der Entwicklung von EX-Programmen.
Weitere Artikel zum Thema: