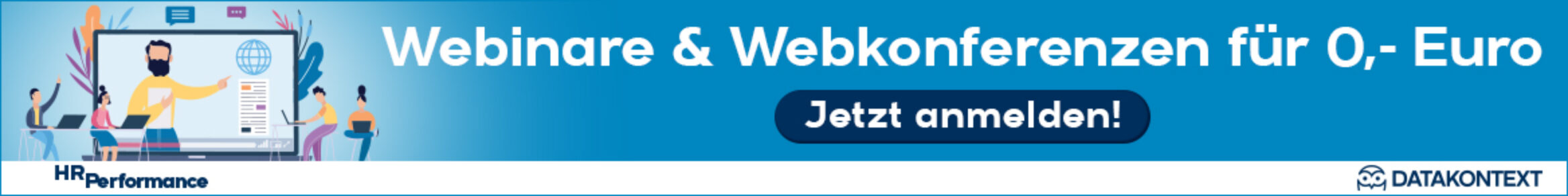Führungskräfte ticken heute anders als vor 30 Jahren
"Die meisten Führungskräfte sind und leben heute zwar gesundheitsbewusster, das heißt aber nicht, dass sie weniger gesundheitlichen Belastungen als früher ausgesetzt sind." Ein Gespräch über den aktuellen Stand zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) von Führungskräften und Leistungsträgern mit Hans-Peter Machwürth, Geschäftsführer des international agierenden Trainings- und Beratungsunternehmens Machwürth Team International (MTI Consultancy).

Die meisten Führungskräfte sind und leben heute gesundheitsbewusster als früher. Trotzdem ist ihre gesundheitliche Belastung oft hoch, unter anderem, weil sie sich in einem permanenten Dauerstress befinden. Ein Gespräch über den aktuellen Stand zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) von Führungskräften und Leistungsträgern mit Hans-Peter Machwürth, Geschäftsführer des international agierenden Trainings- und Beratungsunternehmens Machwürth Team International (MTI Consultancy).
HRP: Herr Machwürth, wie gesundheitsbewusst sind die Führungskräfte im deutschsprachigen Raum?
Hans-Peter Machwürth: Deutlich bewusster als früher. Wenn ich an unsere ersten Gesundheitsmanagement-Seminare vor knapp 30 Jahren zurückdenke, muss ich einfach konstatieren: Die Führungskräfte ticken heute ganz anders.
HRP: Bitte erläutern Sie das genauer.
Machwürth: Vor 30 oder 40 Jahren waren viele Führungskräfte noch passionierte Raucher und auch dem Alkohol sprachen sie nicht selten – aus heutiger Sicht – übermäßig zu. Und Sport trieben sie eher sporadisch, im Winter mal beim Skifahren, im Sommer mal beim Tennis oder Golfspielen. Ansonsten waren die meisten sportlich jedoch eher inaktiv. Und Gesundheitssportarten, also Ausdauersportarten wie Joggen und Walken, betrieben sie recht selten. Das hat sich fundamental geändert. Heute sind die meisten Führungskräfte, wenn überhaupt noch, nur Gelegenheits- oder Genussraucher. Dasselbe gilt für den Alkoholkonsum.
HPP: Das heißt, nur noch gelegentlich eine Zigarette oder ein Glas Wein nach Feierabend?
Machwürth: Ja. Und das regelmäßige Sporttreiben, speziell Joggen, ist heute bei vielen Führungskräften ein integraler Bestandteil ihres Lebensalltags. Auch ihr Ernährungsverhalten hat sich sehr verändert. Es ist heute viel gesundheitsbewusster als noch zur Jahrtausendwende.
HRP: Wenn Führungskräfte heute gesundheitsbewusster leben, sinkt vermutlich auch die Nachfrage nach Leistungen im BGM-Bereich?
Machwürth: Das Gegenteil ist der Fall, unter anderem, weil wir ja nicht kurativ, also heilend, sondern präventiv, also vorsorgend tätig sind. Dass die Führungskräfte gesundheitsbewusster sind, heißt ja unter anderem, dass sie sich stärker für Gesundheitsthemen interessieren. Also auch für solche Fragen: „Wie steht es aktuell um meine Gesundheit?“, oder „Wie kann ich dafür sorgen, dass ich auch künftig mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gesund und leistungsfähig bin?“.
Folglich interessieren sie sich auch stärker für unsere Präventionsangebote. Hinzu kommt: Die meisten Führungskräfte sind und leben heute zwar gesundheitsbewusster, das heißt aber nicht, dass sie weniger gesundheitlichen Belastungen als früher ausgesetzt sind. Die Belastungen sind, so mein Eindruck, sogar gestiegen, auch wenn es heute andere Belastungen als früher sind. Das zeigt unter anderem der starke Anstieg der chronischen und psychischen Erkrankungen in den zurückliegenden Jahren.
HRP: Was sehen Sie als die zentrale Ursache dafür?
Machwürth: Ein zentraler Faktor ist das Thema Stress. Dieser spielt heute, wenn es um die Gesundheitsvorsorge geht, eine viel größer le als früher. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Zum Beispiel führt die Tatsache, dass die sozialen Einheiten in unserer Gesellschaft immer kleiner und fragiler werden, dazu, dass vielen Menschen im Bedarfsfall die erforderlichen sozialen Stützsysteme fehlen – so zum Beispiel, wenn ein Kind, der Lebenspartner oder ein Elternteil erkrankt. Deshalb schlägt ein Gefordert-Sein von ihnen schneller in ein Überfordert-Sein um. Hinzu kommt, nicht nur unsere Lebens-, sondern auch Arbeitswelt wird immer komplexer, weil vernetzter bzw. interdependenter. Zudem ist sie von rascher Veränderung geprägt, weshalb unser Leben beruflich und privat immer schwieriger langfristig planbar wird.
HRP: Was die zurückliegenden Jahre, mit den nur schwer vorhersehbaren Ereignissen wie der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg und ihren Folgen, aber auch den Herausforderungen durch den Klimawandel oder die digitale Transformation, nachdrücklich aufgezeigt haben.
Machwürth: Ja, deshalb stehen insbesondere die Personen in den Unternehmen, auf deren Schreibtischen viele Fäden zusammenlaufen, wie Führungskräfte, aber auch Projektmanager, unter einem permanenten Dauerdruck. Daher besteht bei ihnen latent die Gefahr, dass ihr Gefordert-Sein in ein Überfordert-Sein umschlägt und sie mittel- bis langfristig erkranken. Diese Gefahr ist tendenziell umso größer, je exponierter die Position einer Person in einer Organisation ist, da sich umso mehr Augen voller Erwartungen auf sie richten. Zudem tragen diese Personen in der Regel auch die Verantwortung dafür, dass die nötigen Entscheidungen nicht nur zur rechten Zeit getroffen, sondern auch im Betriebsalltag umgesetzt werden.
Lesen Sie das vollständige Interview in der HR Performance 2/2025.