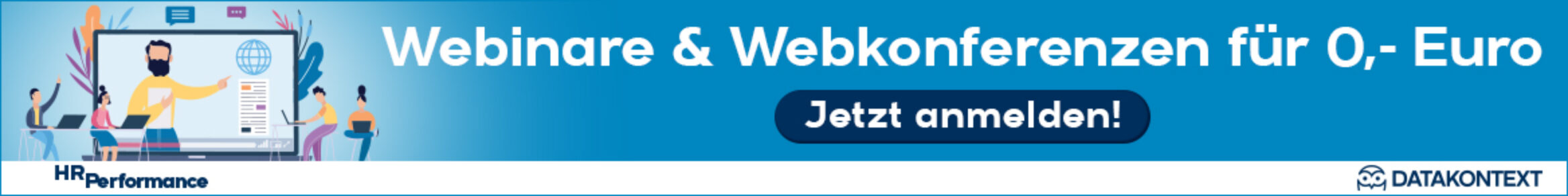Flexibilität ist wichtiger als Mehrarbeit
Wenn Fritzchen in einer Stunde 50 Äpfel pflückt, dann kann er in acht Stunden 400 Äpfel pflücken. Und wenn man das auf den Alltag überträgt, dann kann man doch locker in 42 Stunden 105 Einheiten produzieren, wenn man in 40 Stunden 100 geschafft hat. Doch ist es so einfach?

„Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten“. So formulierte es Bundeskanzler Friedrich Merz Mitte Mai und war nicht der Erste, der nach längeren Arbeitszeiten ruft. Während ich beim Thema Effizienz zustimme, möchte ich das Thema längere Wochenarbeitszeiten am Beispiel von Schichtarbeit kritisch beleuchten.
Lineares Denken wird der Realität nicht gerecht
Grundsätzlich steht hinter dieser Forderung der Viel-hilft-viel-Fraktion ein vereinfachtes, lineares Denken. Schließlich haben wir alle gelernt: Wenn Fritzchen in einer Stunde 50 Äpfel pflückt, dann kann er in acht Stunden 400 Äpfel pflücken. Und wenn man das auf den Alltag überträgt, dann kann man doch locker in 42 Stunden 105 Einheiten produzieren, wenn man in 40 Stunden 100 geschafft hat. Doch so einfach ist es leider nicht, weil es in der Realität ein paar Faktoren gibt, die den Output bei steigenden Wochenarbeitszeiten reduzieren. Mit folgenden Effekten muss man rechnen:
- Die Produktivität pro Stunde nimmt mit steigender Arbeitszeit ab,
- Die Krankenquote nimmt mit steigender Wochenarbeitszeit zu,
- Die Leerstunden steigen ebenfalls mit steigender Wochenarbeitszeit an,
Schauen wir uns das einmal im Detail an. Die Produktivität pro Stunde nimmt mit steigender Arbeitszeit ab. Die Annahme, dass Fritzchen im eingangs genannten Beispiel in acht Stunden 400 Äpfel pflückt, mag mathematisch korrekt sein, ist so aber nicht auf die Realität übertragbar. Ich denke, dass 360 näher an der Realität sind, vor allem, wenn er das an fünf Tagen die Woche machen muss. Die Übernahme des mathematisch linearen Denkens in die Realität wäre vergleichbar damit, dass man die Durchschnittszeit pro Kilometer aus einem 10.000-Meter-Lauf dafür hernimmt, um die benötigte Zeit für einen Marathon hochzurechnen.
Es gibt mittlerweile auch genug Studien, die beweisen, dass die durchschnittliche Produktivität pro Stunde bei niedrigen Tages- und Wochenarbeitszeiten höher ist als bei hohen Arbeitszeiten.
Nicht selten schaffen Teilzeitmitarbeitende pro Stunde mehr als vergleichbare Vollzeitmitarbeitende. Aber neben dem niedrigeren Output pro Stunde sorgen hohe Arbeitszeiten auch dafür, dass von der brutto verfügbaren Arbeitszeit netto weniger übrig bleibt.
Die Krankenquote nimmt mit steigender Wochenarbeitszeit zu
Eine Studie der Gesellschaft für Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologische Forschung e. V. hat ergeben, dass insbesondere bei einer Wochenarbeitszeit von mehr als 39 Stunden das Risiko für Beeinträchtigungen steigt – bei damit einhergehender hoher Belastung sogar überproportional. Und das nicht nur bei krankheitsbedingten Ausfällen, sondern auch durch eine Zunahme von Arbeitsunfällen.
Die Autoren der Studie kommen zu folgendem Schluss: „Die Ausdehnung der Arbeitszeiten als Instrument gegen Wachstumsschwäche und Arbeitsmarktkrise scheint damit eine nicht empirisch abzusichernde, übervereinfachte ökonomische Modellrechnung zu sein, bei der offensichtlich irrtümlich ein linearer Zusammenhang zwischen der Dauer der Arbeitszeit und dem Arbeitsergebnis unterstellt wird, vergleichbar mit dem zur Laufzeit (weitgehend und in Grenzen) proportionalen Ausstoß einer Maschine.“
Dies deckt sich auch mit Erfahrungen aus meiner Beratungspraxis, wonach Unternehmen mit einer 40-Stunden-Woche im vollkontinuierlichen Schichtbetrieb in der Regel eine mindestens um drei bis fünf Prozent höhere Krankenquote haben als vergleichbare Unternehmen mit einer 35-Stunden-Woche. Wenn man sich vollkontinuierliche Schichtpläne auf Basis von 40 Stunden wie in der folgenden Abbildung (Abbildung 1) ansieht, muss man sich nicht wundern, warum die Krankenquote hochgeht:
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
F | F | F | S | S | N | N |
F | F | S | S | S | ||
N | N | F | F | S | ||
S | N | N | N |
Arbeitsblöcken von sieben Tagen am Stück folgen nur zwei freie Tage, wobei man am ersten „freien“ Tag je nach Entfernung zum Arbeitsplatz erst um sieben oder acht Uhr morgens nach Hause kommt. Es gibt also eigentlich nur einen freien Tag, an dem man abends bereits wieder früh ins Bett gehen muss, weil am Folgetag wieder eine Frühschicht ansteht. Bei 7,5 Stunden pro Tag hat dieser Plan eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 39,375 Stunden, pro Monat hat man nur ein freies Wochenende. Jeder kann anhand dieses Plans für sich überlegen, inwieweit es realistisch ist, in einem vollkontinuierlichen Betrieb 42 Stunden pro Woche arbeiten zu müssen, und was das für die Krankenquote bedeuten würde.
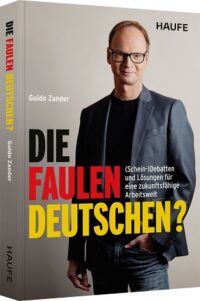
Buchtipp zum Thema
Die Aussagen dieses Beitrags stammen aus dem neuen Buch „Die faulen Deutschen? – (Schein-)Debatten und Lösungen für eine zukunftsfähige Arbeitswelt“ von Guido Zander, in dem der Autor noch viele weitere Thesen zum Thema Arbeitszeit bewertet und alternative Lösungen vorschlägt.
Bibliografische Daten
Haufe, Auflage 2025, 240 Seiten
ISBN: 978-3-68951-054-1
Preis: 22,00 Euro